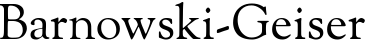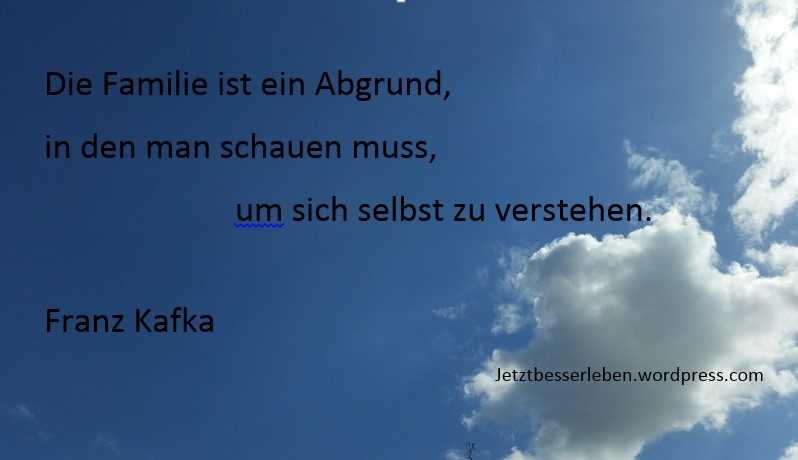Bin ich ein Suchtkind? Könnte „Vater, Mutter, Sucht“ auch die Überschrift über Ihrer Kindheit sein?
Viele Erwachsene aus suchtbelasteten Familien wissen nicht, ob sie wirklich als betroffen gelten. Sie fragen sich oftmals quälend: „Bin ich ein Suchtkind?“ Denn Vater, Mutter, Kind: dieses alte Kinderspiel erfährt in Familien mit Suchtkranken eine tragische Abwandlung. Wenn Eltern suchtkrank sind, nehmen ihre Kinder einen anderen Platz ein, als es bei Kindern mit gesunden Eltern der Fall ist. Bei einem Menschen, der an einer Sucht leidet, kommt diese immer an erster Stelle. Die Sucht nimmt den Platz ein, der eigentlich den Kindern zusteht. Das Handeln des Süchtigen ist nicht auf seine Kinder, sondern auf sich und das Suchtmittel konzentriert, letzteres ist bei Suchtkranken der Dreh- und Angelpunkt. Wie und wann ist das Suchtmittel zu bekommen? Wie ist es zu vermeiden. Das sind die Fragen, die den Alltag bestimmen. Die Gedanken eines alkoholkranken Elternteils kreisen letztlich nur darum, wie er an Alkohol kommen kann, der Tablettensüchtige denkt ständig an seine Tabletten, der Drogensüchtige an seinen Stoff, der Workaholic an seine Arbeit usw. Dies bleibt nicht ohne Folgen für das System, für die Umgebung, in der Suchtkranke leben, hier vor allem für die Familien.
Alle in der Familie sind von der Sucht betroffen
Der Gebrauch des Suchtmittels greift in das Familienleben ein, bestimmt, wie die Mitglieder zusammen leben können oder eben auch nicht mehr.
So bekommen Kinder aus Suchtfamilien ungewollt einen Platz zugewiesen, der ihnen wenig gerecht wird. Die mit der elterlichen Sucht einhergehende Belastung wird nie mehr von ihnen weichen, denn wie eine Betroffene es ausdrückte: »Suchtkind bleibt man ein Leben lang!« Selbst wenn sie das Elternhaus schon lange verlassen haben oder der süchtige Elternteil verstorben ist: Sucht gleicht einem Zombie, der die Seelen der Kinder zu zerfressen droht – und das unbemerkt. Die Menschen aus dem Umfeld werden leicht zu Statisten, zu hilflosen Zuschauern, die unbeteiligt wegsehen, weil das Leid und die Ohnmacht zu unfassbar erscheinen, nicht begreifbar, nicht veränderbar. So sehen Erzieher/innen, Lehrer/innen und Nachbarn in der Regel untätig zu, während sich hinter den verschlossenen Türen der Suchtfamilie womöglich tagtäglich Dramatisches abspielt. Die Kinder dürfen nicht über ihr Leid sprechen, die Eltern schweigen aus Scham. Wenn sie doch mit ihrer Sucht an die Öffentlichkeit gehen, finden sie vielleicht einen Platz, an dem ihnen geholfen wird, ihre Kinder dagegen bleiben meistens selbst dann noch auf tragische Weise im Abseits.
Kommt die Sucht, wie so oft, nicht laut, sondern mehr schleichend, leise daher, wird es noch schwieriger, sie zu erkennen. Die Belastung für die Betroffenen nimmt immens zu, denn sie fragen sich, ob es diese Sucht überhaupt gibt oder gab, ob sie sich diese nur einbilden. »Ist das nicht normal, was meine Eltern da gemacht haben!«, lautet dann die Frage der Verunsicherten, oder: »Ist es nicht normal, dass Mama täglich Tabletten nimmt, die sie doch braucht!«, »Ist es nicht normal, ein paar Bier zu trinken?«, »Ist es nicht normal, auf sein Gewicht zu achten?« Oft noch als Erwachsene sind die Kinder suchtkranker Eltern tief verunsichert.
____________________________________________________________________________________________________
Übung 4: Bin ich ein „Suchtkind“?
Vielleicht fragen Sie sich, ob sie selbst zum Kreis der betroffenen Erwachsenen gehören, die hier (auch im Buchtitel) angesprochen werden. Das wäre sehr typisch für die Art und Weise, wie erwachsene Kinder aus Suchtfamilien mit ihrer Kindheitsbelastung umgehen. »Suchtkinder«, wie ich erwachsene Kinder suchtkranker Eltern hier im Folgenden nennen möchte, nehmen oft grundsätzlich an, dass dieses Thema aus Kindertagen erledigt sei, und zum anderen, dass sie keine Probleme haben, oder wenn doch, dass diese Probleme (Symptome etwa körperlicher Art) nichts mit der früheren Situation in der Herkunftsfamilie zu tun haben. Dies kann ein tragischer Fehlschluss sein, mit weitreichenden Folgen für Ihre Lebensqualität…

Was Suchtkinder erzählen
Zitate aus Befragungen (2008/2009; 2015) im Folgenden unkommentiert: Vielleicht finden Sie sich oder jemanden, der Ihnen wichtig ist, in diesen Aussagen wieder?
Die nachfolgenden Zitate stammen von Erwachsenen, die über mehrere Jahre mit suchtkranken Eltern gelebt haben:
„Es (das Suchtverhalten/ Anm. d.Verf.) war in unserer Familie zu einem stummen Thema geworden!“/Frau L.
„Es ging fortwährend darum, dass wir nach Außen eine perfekte Fassade lieferten – wie es mir ging, spielte keine Rolle!“/Frau I.
„… denn offensichtlich ist dieser familiäre Wahnsinn das Leben!“/Frau H.
„Wenn meine Mutter schreckliche Dinge im Suff getan hatte, taten alle so, als wäre nichts passiert!“/Frau Z.
„… ich bettle schon ein Leben lang um Liebe.“/Frau I.
„Entsetzt bemerkte ich, dass es dieses „Ich“ nicht mehr gab!“ /Frau I.
„… ich verschwinde, während ich sein Verschwinden zu verhindern suche.“/Frau E.
„Wir sind du und du bist wir!“/Frau E. zur Einstellung ihrer Mutter
„Ich habe lieber, wenn etwas Schreckliches passiert! – Wenn es mal gut ist, warte ich nur auf das Schreckliche- das WARTEN ist noch furchtbarer“/Frau I.
„Vielleicht hätte ich ihn mehr lieben müssen! Dann hätte mein Vater vielleicht nicht getrunken“ (Frau S.)
„Ich tanze auf einer Hochspannungsleitung im kühlen Korsett!“/Frau P.
„Und ich war ihrer Ansicht nach schuld, dass sie immer mehr trank…“/Herr I.
„Drogen waren für meine Eltern „Lifestyle“- sprach ich von Belastung wurde ich ausgelacht und als spießig dargestellt.“/Herr H.
„Bei uns zu Hause gab es gar keine Grenzen.“/Frau O.
„Ich habe oft schon Angst gehabt, bevor meine Mutter nach Hause gekommen ist/Felix
„…alle Männer in unserer Familie waren depressiv…und süchtig.“ (Frau G)
„Ich kann ihm wirklich nicht die Mutter ersetzen!“ (Frau R.)
„Wir waren voll mit Gefühlen, die aus der Suchterkrankung resultierten und doch durften wir nie über unsere Gefühle reden. Gefühle waren das absolute Tabu!“/Herr I.
Wenn einige dieser Aussagen auch von Ihnen stammen könnten und sie sich zugleich schon lange fragen, ob das Verhalten ihrer Eltern mit dem Etikett „süchtig“ zu bezeichnen ist/war, dann könnten das Hinweise auf eine (möglicherweise auch verdeckte) elterliche Suchterkrankung oder andere familiäre Belastungen in der Kindheit sein. Vielfach ist die elterliche Suchterkrankung, wie Suchtkinder oftmals fälschlich annehmen, nicht nur an der konsumierten Menge fest zu machen (und auf die Kontrolle und Beweisführung wird oft viel Energie bei Angehörigen verwendet): Bedeutsamer und wirksamer für den eigenen Weg der Suchtkinder ist das Aufspüren krankmachender Familiendynamiken sowie der spezifischen Familienatmosphäre. Denn diese Dynamik und Atmosphäre kann massive Auswirkungen auf das Erleben der Suchtkinder haben, sogar wenn sie viele Jahrzehnte zurückliegt. Wenn Sie sich oftmals, (scheinbar grundlos) leer, schuldig und „unnütz“, nicht „richtig“, nicht zugehörig oder wertlos fühlen (obwohl sie z.B. „objektiv“ viel leisten), dann kann die Wurzel dieser Gefühle in elterlicher Suchterkrankung begründet sein.Dann kann es für Sie wichtig sein, sich mit Familienatmosphären näher zu beschäftigen. Häufig stellen Suchtkinder in dieser Beschäftigung fest, dass diese negativen Stimmungen und Gefühle eigentlich gar nicht zu ihnen gehören, sondern zu ihren belasteten Eltern. Diese haben sie über Jahre während ihrer Erkrankung, meist unbewusst, an sie weitergegeben oder abgegeben (delegiert).
Zusatzanregung: Suchen Sie ein Musikstück, das erzählt, wie Sie sich eine gute Familienatmosphäre vorstellen…Lassen Sie sich Zeit: Hören Sie in den nächsten Tagen Stücke im Radio oder zu Hause bewusster aus dieser Perspektive.
__________________________________________________________________________________________________
Zu Beginn meiner Tätigkeit habe ich, wie viele professionell Tätige in diesem Bereich, mit erwachsenen Kindern aus Suchtfamilien gearbeitet, ohne wirklich das Ausmaß ihrer Belastung zu kennen. In meiner Praxis, in der Schule, in Ausbildungszusammenhängen gehörte dieses Thema zu meinem Aufgabenfeld, doch ich bemerkte zunächst nicht, wie weitreichend die Folgen der elterlichen Suchtbelastung wirklich waren – ich wusste ebenso wenig darum wie die Betroffenen selbst. Erwachsene Kinder aus Suchtfamilien ahnen oftmals nichts von ihrer Belastung und deren Ausmaß, sie sprechen nicht über ihre Herkunftsfamilie, scheint das alles doch viel zu lange her zu sein. Viele wissen nicht mehr, dass ihnen etwas angetan wurde – aufgrund diffuser körperlicher und seelischer Beschwerden merken sie nur, dass irgendetwas nicht mit ihnen stimmt. Da ihnen das Ausmaß selbst nicht bewusst ist, sie zudem gelernt haben, zu tabuisieren und zu verdrängen, sprechen sie nicht über das in der Kindheit Erlittene. Betroffene lebten und leben mit Eltern, die ihre Sucht verleugnen, und so verleugnen sie selbst, was ihnen angetan wurde.
Es soll nicht etwa »Grässliches«, Schlimmes und Traumatisches, das in Suchtfamilien passiert ist, gewaltsam an die Oberfläche gezerrt oder als Sensation zur Schau gestellt werden, vielmehr wird versucht, mit Hilfe eines gemeinsamen Blicks auf die kindliche Vergangenheit, eine neue Basis für ein zufriedeneres Leben mit sich und anderen zu schaffen.
Frau L. 44 Jahre: „Ich habe eigentlich neu laufen gelernt!“
„Ich fühlte mich vor der Therapie wie in einem Hamsterrad gefangen. Alles war schwarz und grau. Ich sah und spürte nichts mehr, ich wusste weder, wo ich hinwollte, noch warum sich alles so furchtbar anfühlte – ich gab mir daran die Schuld. Jetzt fühle ich mich gut, was mir auch sehr fremd ist, da es das in meinem Leben so wenig gab. Da brauche ich immer wieder Mut, dem Neuen zu vertrauen. Ich glaube, mir hat geholfen, dass ich in der Therapie Schritt für Schritt Begleitung hatte. Ich musste bei jedem noch so kleinen Schritt Hilfe haben, ob er gerade wieder wirklich für mich stimmig ist, ob es richtig ist für mich – oder ob ich nur reagiere auf das, was andere erwarten.
Das war mühsam, aber ich empfinde nun oftmals Frieden und Freude. Ich musste von Stunde zu Stunde Wegweiser haben, um jeweils zu wissen, wie es genau weitergeht. Ich habe eigentlich neu laufen gelernt. Es haben sich neue Ziele und Blickwinkel in dieser Zeit entwickelt. Ich habe meine Belastungen erkannt und abgeworfen.„
Nach meinen Erfahrungen können erwachsene Kinder, auch wenn die Erfahrungen mit süchtigen Eltern schon Jahrzehnte zurückliegen, nur dann wirkliches Verständnis für sich selbst, ihr Verhalten, ihre Gefühle und ihre Nöte entwickeln, wenn sie einen Blick auf das, was ihnen angetan wurde, wagen. Oftmals sind sie erst dann in der Lage, ihre Stärken zu würdigen und Rollenmodelle des eigenen Lebens zu verstehen – im Buch Vater, Mutter, Sucht ermöglicht ein Selbsttest darüber näheren Aufschluss. Mittels meiner Forschungen und Praxiserfahrungen habe ich das AWOKADO-Programm zusammengestellt, das Suchtkinder auf dem Weg in ein glücklicheres Leben unterstützen kann; auch professionell Tätige können es bei der Arbeit mit Suchtkindern einsetzen. Wer verdrängt, steckt fest! Wer hinschaut und aktiv wird, kann wachsen – …
Text in Anlehnung an eine Leseprobe zu Vater, Mutter, Sucht beim Klett-Cotta-Verlag.