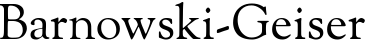Klopfen Sie sich mal selbst auf die Schulter
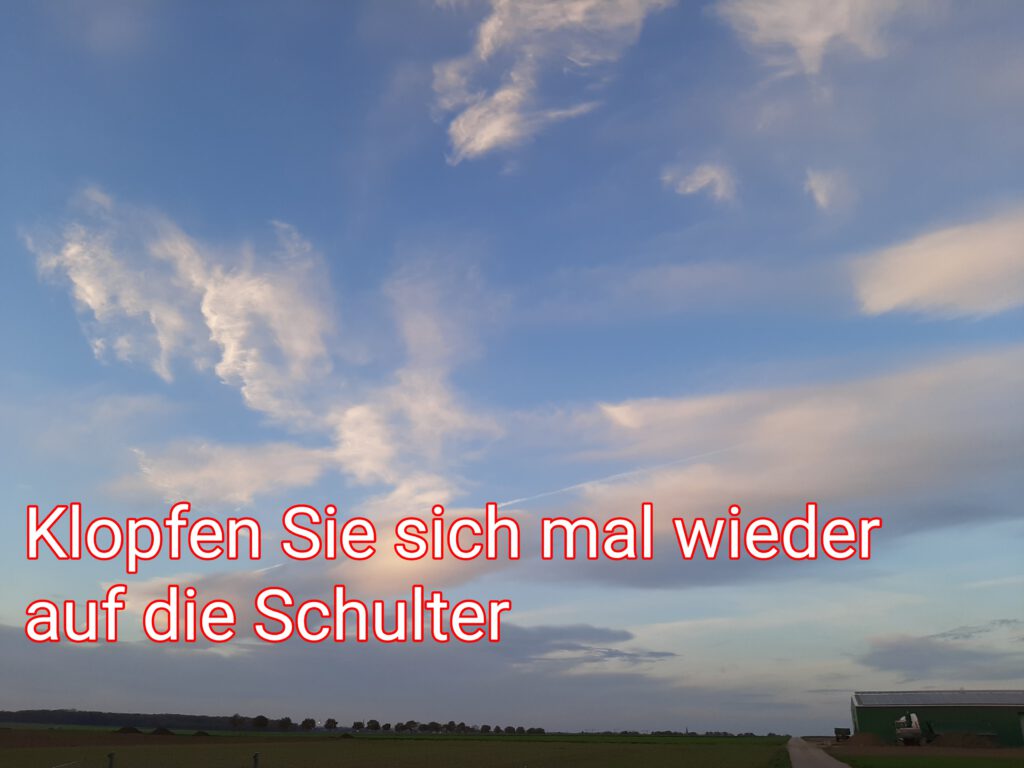
Wie mag es Ihnen gerade ergehen in diesen besonderen Zeiten? Gehören Sie zu denjenigen, die gerade mehr arbeiten müssen? Im Beruf, in der Familie, vielleicht mit zeitlich mehr Präsenz und unter ungleich schwierigeren Bedingungen? Oder gehören sie zu denjenigen, die sogar unmittelbar von der Krankheit Covid 19 betroffen waren, mit Krankheitssymptomen, Quarantäne …oder als mitbetroffene Anghehörige? Leben Sie alleine und müssen nun in diesen Zeiten sehr viel Zeit alleine verbringen, verspüren vielleicht oft Einsamkeit? Wir alle durchleben gerade unterschiedliche Lebenswirklichkeiten in einer uns weltweit gemeinsamen Pandemiezeit.
In der Zusammenarbeit mit Erwachsenen aus belasteten Familien fallen mir in dieser Zeit auf: die erhöhte Leistungsbereitschaft und die zugleich wenig bis garnicht vorhandene Würdigung dieser Krisenmeisterung.
Leisten bis der Arzt kommt
Menschen, die in belasteten Familien aufgewachsen sind, übernehmen oft früh Verantwortung und werden selbst von den erkrankten Eltern, die um sich und ihre Erkrankung kreisen, oft wenig gesehen:, so können die Kinder wenig Selbstwert aufbauen. Diesen geringen Selbstwert kompensieren die betroffenen Kinder, indem sie besonders viel leisten. Da diese Leistungen meist ebenso wenig gewürdigt werden durch die Erwachsenen, internalisieren die Kinder die fehlende Wertschätzung: sie erleben ihr eigenes Tun als bedeutungslos und wenig wertvoll. Sie strengen sich aber weiter an, gehen über ihre Grenzen, leisten“ bis der Arzt kommt“- so finden wir oft gerade hier Burnoutpatienten.
Gerade geht es weiter mit Lockdown light. Kann es sein, dass auch gerade Sie viel geschafft haben in dieser jetzigen Krise: Innovatives, Anpassungsbereitschaft, Einsatz, Mitmenschlichkeit.?Weil gerade Sie durch Ihre Lebenserfahrung eine KrisenmeisterIn sind, aber eben auch wenig Wertschätzung für dieses Meistern besitzen?
Eine biografische Antwort auf die Krise finden
Mit der Stunde der Geburt beginnt die Übung gegen die Unsicherheit und Zweifel im Leben die eigene biografische Melodie zu setzen.Durch Erorberungen, Erschütterungen, Laufbahnen, Fehltritte und Krisen hindurch drehen wir Lebensjahr für Lebensjahr den Film unseres Lebens. Wir selbst sind die Drehbuchautoren, führen Regie, spielen verschiedene Rollen…“
Annelie Keil: Auf brüchigem Boden Land gewinnen
Mit diesem Impuls der Woche möchte ich Sie ermuntern, den Film Ihres Lebens neu anzuschauen: aus der wertschätzenden Perspektive. Eine Ermutigung, sich doch selbst endlich auf die Schulter zu klopfen; das haben Sie vermutlich verdient. Und da die Corona-Krise noch einige Zeit andauern wird, haben Sie dieses Schulterklopfen auch dringend nötig – die Aussicht auf den Impfstoff kann nun zu Hoffnungen berechtigen, dass die massive Krise endlich scheint- aber wir brauchen weiter langen Atem.
Kreatives Selbstcoaching (30 Minuten einplanen )
Schreiben Sie auf, was Sie persönlich in der Zeit seit des Ausbruchs des Virus ( in Deutschland ca seit Ende Februar 2020) anders, gut, mehr gemacht haben, pro Aspekt ein neues Blatt.
Gestalten Sie ein Symbol auf das Blatt.
Ordnen Sie die Blätter. Fügen Sie noch ei weiteres hinzu. Geben Sie Ihrer Gestaltung einen würdigenden Platz.Schauen Sie sie in dieser Woche mindestens einmal am Tag an…
Wenn sich dieses Tun fremd anfühlt, machen Sie gerade wahrscheinlich den besten ersten Schritt in ein neues Drehbuch…Regisseurin Ihres Lebens-KunstWerks.
Eine gute Woche wünscht
Ihre
Waltraut Barnowski-Geiser