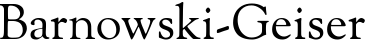Wenn gestern nicht einfach vorbei ist… Wie wir schwierige Kindheitserfahrungen überwinden
Wenn Menschen als Kinder in ihren Familien Ungutes erlebt haben, und das oftmals über Jahre hinweg, manchmal von Geburt an, dann trifft der Ausspruch „Vorbei ist vorbei!“ bei ihnen oftmals einen sehr empfindlichen Nerv. So wahr diese Aussage, (oftmals von Angehörigen oder Freunden sogar durchaus gut gemeint) auch an den aktuellen Fakten gemessen sein mag, so wenig hilft sie Betroffenen: denn ihr tägliches Erleben ist ein anderes. Sie fühlen sich oftmals innerlich, scheinbar grundlos, ängstlich, überfordert und hilflos, und das, obwohl sie im Außen oftmals Ungeheures leisten. Treten im Außen Krisen auf, wie etwa die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine, wirken diese Ereignisse verstärkend, wie Trigger in alte Krisenzeiten.
Was passiert genau bei diesen Menschen? Lassen Sie uns, um das genauer zu verstehen, neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu Rate ziehen. Wir wissen heute (und natürlich sind Beschreibungen für diese hochkomplexen Vorgänge zwangsläufig sehr vereinfachend), dass unser Gehirn sich so aufbaut, wie es genutzt wird. Die Verschaltung der Synapsen ist also nutzungsabhängig, bestimmt von anschwellenden und abschwellenden Erregungspotenzialen. Das gilt auch, so beschreibt es etwa Gerald Hüther in seinem Buch „Biologie der Angst“, für emotionale Verschaltungen. Wenn also ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, in der die Eltern große eigene Probleme haben, dann wird es schon als Säugling viel davon mitbekommen, dazu in Resonanz gehen. Wir wissen heute aus entwicklungspsychologischen Forschungen, dass schon Säuglinge viel mehr wahrnehmen als wir je angenommen haben: auch Atmosphären, Stimmungen, Emotionen. Stellen wir uns eine Familie vor: vielleicht lebt hier ein suchtkranker Vater, der, wenn er trinkt laut wird und Streit anfängt, täglich über sich die Kontrolle verliert und eine Mutter, die sich liebevoll um ihr Baby kümmert, aber durch die Probleme mit dem Ehemann gereizt und an ihren Grenzen der Belastbarkeit angekommen ist: all dies wird ihr Baby mitbekommen, Angst und Schrecken gleichsam mit der Muttermilch aufsaugen. Auf das Wahrgenommene kann das Baby unterschiedlich reagieren: eine Möglichkeit zu reagieren kann sein, Angst zu entwickeln. Aus dieser befeuerten Hirnspur der ersten Lebensmonate, der verschalteten Synapsenspur der Angst, wird leicht ein breiterer Hirnweg, wenn er künftig täglich genutzt wird. Wird, um im Bild zu bleiben, die Angstspur lange Zeit und wiederholt gefahren (etwa weil die Sucht und die damit vorhandenen familiären Probleme stärker werden), kann sie zu einem breiten Trampelpfad, einer regelrechten Hirnautobahn werden. Wird diese Autobahn über Jahre, gar Jahrzehnte so weiter genutzt, dann kann es passieren, dass unser Säugling, nennen wir ihn hier Suchtkind, auch als erwachsene Frau mit 40 oder gar 60 Jahren alltäglich auf dieser Angstautobahn fährt. Sie hat den Eindruck, gar nicht anders fahren zu können. Scheinbar hat sie grundlos Angst, gibt es doch aktuell gar keinen Anlass zu Ängsten und Sorgen. Frau Suchtkind fühlt sich nun ihren Gefühlen hilflos aufgeliefert. Doch das heutige Gefühl ist nicht sinnlos, auch wenn Frau Suchtkind es berechtigter Weise als unangenehm empfindet: dieses Gefühl macht unsere Frau Suchtkind darauf aufmerksam, dass das früh als Kind Erlebte heute Hinwendung und Zuwendung verlangt.
Nicht mehr Fühlen – auch ein (Paar)-Problem
So wie sich Frau Suchtkind ständig sorgt und ängstigt, gibt es andere Menschen mit unguten Kindheitserfahrungen, die andere Bewältigungsstrategien gefunden haben: sie fühlen nicht mehr. Gefühle, das haben sie bemerkt, sind ungeheuer schmerzhaft. Damit soll Schluss sein! Sie wollen sich nicht mehr erschüttern lassen. Dieser Vorgang läuft nicht bewusst ab, sondern ist oftmals ein Schutzmechanismus der Seele, den Betroffene selbst nicht einmal bemerken. Oftmals bemerken sie erst erst durch die Rückmeldungen von anderen, dass etwas problematisch und nicht ganz in Ordnung ist. Die Partnerin etwa drängt: „Mach mal Therapie, ich komme nicht an dich heran!“ Eine neuerliche Verzweiflung. Sich mit diesen schlimmen Erfahrungen auf einen fremden Menschen einlassen, gar einen Therapeuten, wo sich Betroffene selbst schon manchmal fragen, ob mit ihnen noch alles stimmt? Dann besser nichts machen! Und nun stecken sie fest. Derart Betroffene und ihre Partner stecken oft in Krisen fest, die von großer Sprach-und Hilflosigkeit gezeichnet sind. Neben Angst und Gefühllosigkeit, Scham und Schuld, leidet dann mit der Zeit vor allem eines: das eigene Selbstwertgefühl. Die Lebensqualität leidet, Betroffene bleiben unter ihren eigenen Möglichkeiten zurück- sie sind unzufrieden, fühlen sich diffus unzulänglich – ihr Umfeld, vor allem ihre Beziehung, leidet oft mit. Und wieder droht eine Familie unglücklich zu werden, so wie es die Betroffenen aus ihrer Herkunftsfamilie kennen- und gerade das wollten sie in ihrem Leben doch unbedingt vermeiden. Ein Teufelskreis.
Der erste Schritt aus dem Dilemma
Was kann aus diesem Dilemma heraushelfen? Der erste Schritt ist der schwierigste: er bedeutet, wahrzunehmen, was wirklich los ist. Dazu gehört viel Mut. Vielleicht brauchen Sie dabei Unterstützung. Einen Menschen, der die Belastungen, die sie getragen haben, würdigen kann, aber der auch mit ihnen einen Blick auf Ihre Stärken und das, was sie bis heute geschafft haben, werfen kann. Die Würdigung der Belastungserfahrung und die Würdigung der eigenen Stärken, die sie aus und in diesen Krisen entwickelt haben, beschrieben Menschen in meinen Befragungen als einen der wichtigsten Hilfefaktoren, sich besser und entlasteter zu fühlen (Barnowski-Geiser (2015): Vater, Mutter, Sucht). Kreative Wege eröffnen Möglichkeiten, sich diesen Stärken anzunähern. Sie ermöglichen uns, neue Hirnspuren zu ebnen und Abfahrten von der alten Autobahn. Da folgt der zweite Schritt, der im Angesicht von schwierigen Kindheitserfahrungen zugegeben sehr schwer ist: Sie müssen an die Möglichkeit der eigenen Veränderung glauben!
Alles Beste in diesen schwierigen Zeiten wünscht
Ihre
Waltraut Barnowski-Geiser
Wenn gestern nicht einfach vorbei ist… Schwierige Kindheitstage trotzdem überwinden!
Wenn Menschen als Kinder in ihren Familien Ungutes erlebt haben, und das oftmals über Jahre hinweg, manchmal von Geburt an, dann trifft der Ausspruch „Vorbei ist vorbei!“ bei ihnen oftmals einen sehr empfindlichen Nerv. So wahr diese Aussage, (oftmals von Angehörigen oder Freunden sogar durchaus gut gemeint) auch an den aktuellen Fakten gemessen sein mag, so wenig hilft sie Betroffenen: denn ihr tägliches Erleben ist ein anderes. Sie fühlen sich oftmals innerlich, scheinbar grundlos, ängstlich, überfordert und hilflos, und das, obwohl sie im Außen oftmals Ungeheures leisten.
Was passiert genau bei diesen Menschen? Lassen Sie uns, um das genauer zu verstehen, neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu Rate ziehen. Wir wissen heute (und natürlich sind Beschreibungen für diese hochkomplexen Vorgänge zwangsläufig sehr vereinfachend), dass unser Gehirn sich so aufbaut, wie es genutzt wird. Die Verschaltung der Synapsen ist also nutzungsabhängig, bestimmt von anschwellenden und abschwellenden Erregungspotenzialen. Das gilt auch, so beschreibt es etwa Gerald Hüther in seinem Buch „Biologie der Angst“, für emotionale Verschaltungen. Wenn also ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, in der die Eltern große eigene Probleme haben, dann wird es schon als Säugling viel davon mitbekommen, dazu in Resonanz gehen. Wir wissen heute aus entwicklungspsychologischen Forschungen, dass schon Säuglinge viel mehr wahrnehmen als wir je angenommen haben: auch Atmosphären, Stimmungen, Emotionen. Stellen wir uns eine Familie vor: vielleicht lebt hier ein suchtkranker Vater, der, wenn er trinkt laut wird und Streit anfängt, täglich über sich die Kontrolle verliert und eine Mutter, die sich liebevoll um ihr Baby kümmert, aber durch die Probleme mit dem Ehemann gereizt und an ihren Grenzen der Belastbarkeit angekommen ist: all dies wird ihr Baby mitbekommen, Angst und Schrecken gleichsam mit der Muttermilch aufsaugen. Auf das Wahrgenommene kann das Baby unterschiedlich reagieren: eine Möglichkeit zu reagieren kann sein, Angst zu entwickeln. Aus dieser befeuerten Hirnspur der ersten Lebensmonate, der verschalteten Synapsenspur der Angst, wird leicht ein breiterer Hirnweg, wenn er künftig täglich genutzt wird. Wird, um im Bild zu bleiben, die Angstspur lange Zeit und wiederholt gefahren (etwa weil die Sucht und die damit vorhandenen familiären Probleme stärker werden),kann sie zu einem breiten Trampelpfad, einer regelrechten Hirnautobahn werden. Wird diese Autobahn über Jahre, gar Jahrzehnte so weiter genutzt, dann kann es passieren, dass unser Säugling, nennen wir ihn hier Suchtkind, auch als erwachsene Frau mit 40 oder gar 60 Jahren alltäglich auf dieser Angstautobahn fährt. Sie hat den Eindruck, gar nicht anders fahren zu können. Scheinbar hat sie grundlos Angst, gibt es doch aktuell gar keinen Anlass zu Ängsten und Sorgen. Frau Suchtkind fühlt sich nun ihren Gefühlen hilflos aufgeliefert.Doch das heutige Gefühl ist nicht sinnlos, auch wenn Frau Suchtkind es berechtigter Weise als unangenehm empfindet: dieses Gefühl macht unsere Frau Suchtkind darauf aufmerksam, dass das früh als Kind Erlebte heute Hinwendung und Zuwendung verlangt.
Nicht mehr Fühlen – auch ein (Paar)-Problem
So wie sich Frau Suchtkind ständig sorgt und ängstigt, gibt es andere Menschen mit unguten Kindheitserfahrungen, die andere Bewältigungsstrategien gefunden haben: sie fühlen nicht mehr. Gefühle, das haben sie bemerkt, sind ungeheuer schmerzhaft. Damit soll Schluss sein! Sie wollen sich nicht mehr erschüttern lassen. Dieser Vorgang läuft nicht bewusst ab, sondern ist oftmals ein Schutzmechanismus der Seele, den Betroffene selbst nicht einmal bemerken,Oftmals bemerken sie erst erst durch die Rückmeldungen von anderen, dass etwas problematisch und nicht ganz in Ordnung ist. Die Partnerin etwa drängt: „Mach mal Therapie, ich komme nicht an dich heran!“ Eine neuerliche Verzweiflung. Sich mit diesen schlimmen Erfahrungen auf einen fremden Menschen einlassen, gar einen Therapeuten, wo sich Betroffene selbst schon manchmal fragen, ob mit ihnen noch alles stimmt. Dann besser nichts machen! Und nun stecken sie fest. Derart Betroffene und ihre Partner stecken oft in Krisen fest, die von großer Sprach-und Hilflosigkeit gezeichnet sind. Neben Angst und Gefühllosigkeit, Scham und Schuld, leidet dann mit der Zeit vor allem eines: das eigene Selbstwertgefühl. Die Lebensqualität leidet, Betroffene bleiben unter ihren eigenen Möglichkeiten zurück- sie sind unzufrieden, fühlen sich diffus unzulänglich – ihr Umfeld leidet oft mit.Und wieder droht eine Familie unglücklich zu werden, so wie es die Betroffenen aus ihrer Herkunftsfamilie kennen- und gerade das wollten sie in ihrem Leben doch unbedingt vermeiden. Ein Teufelskreis.
Der erste Schritt aus dem Dilemma
Was kann aus diesem Dilemma heraushelfen? Der erste Schritt ist der schwierigste: er bedeutet, wahrzunehmen, was wirklich los ist. Dazu gehört viel Mut. Vielleicht brauchen Sie dabei Unterstützung. Einen Menschen, der die Belastungen, die sie getragen haben, würdigen kann, aber der auch mit ihnen einen Blick auf Ihre Stärken und das, was sie bis heute geschafft haben, werfen kann. Die Würdigung der Belastungserfahrung und die Würdigung der eigenen Stärken, die sie aus und in diesen Krisen entwickelt haben, beschrieben Menschen in meinen efragungen als einen der wichtigsten Hilfefaktoren, sich besser und entlasteter zu fühlen (Barnowski-Geiser (2015): Vater, Mutter, Sucht). Kreative Wege eröffnen Möglichkeiten, sich diesen Stärken anzunähern. Sie ermöglichen uns, neue Hirnspuren zu ebnen und Abfahrten von der alten Autobahn. Da folgt der zweite Schritt, der im Angesicht von schwierigen Kindheitserfahrungen zugegeben sehr schwer ist: Sie müssen an die Möglichkeit der eigenen Veränderung glauben!